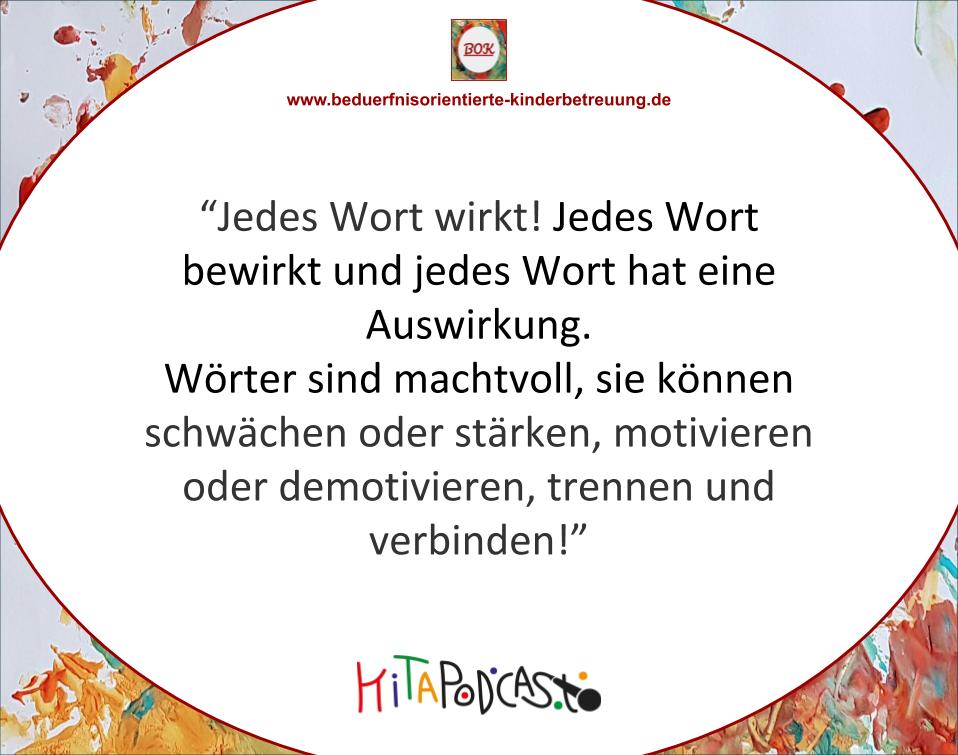Jedes Wort wirkt! Jedes Wort bewirkt etwas! Jedes Wort hat eine Auswirkung!
Worte sind kraftvoll, machtvoll, sie schwächen oder stärken, sie demotivieren oder sie motivieren, sie trennen und verbinden.
Wir geben den Kindern mit bewusst gewählten Worten halt weil sie genau wissen, was wir meinen. Deshalb sollten wir bewusst auf unsere Sprache und unsere Wortwahl achten.
Die Veränderung unserer Wortwahl braucht Zeit weil unser Gehirn bekannte Sprachmuster bevorzugt und neue Spracharten mühsam lernen muss. Deshalb ist es notwendig, dass wir die Nutzung der neuen Worte immer wieder üben. Dabei durchlaufen wir drei Phasen:
- Wahrnehmung: uns fällt auf, wie oft wird diese Wörter benutzen
- Anwendung: du versuchst Sätze umzuformulieren und Worte wegzulassen oder zu ersetzen. Das fällt am Anfang schwer und wird immer besser. Dabei fällt dir vielleicht irgendwann auf, wie oft andere dieses Wort benutzen und ärgerst dich evtl. sogar darüber.
- Integration: du wählst die Wörter nun ohne Anstrengung, automatisch und hast die Formulierungen integriert.
In diesem ersten Teil blicken wir nun darauf, welche Worte wir hinterfragen, uns ihre Wirkung bewusst machen und sie gegebenenfalls verändern. Wir schauen uns dabei die folgenden Wörter an:
| lieb | nicht | sollen | Diva | Wenn…dann | Gleich |
| brav | Man | müssen | Memme | Mäuschen | Aber |
| gut | Super | böse | Prinzessin | Püppi | Immer |
| richtig | Schön | Ordentlich | Trampel | vorsichtig | schnell |
| falsch | Toll | Macker | Zicke | Entschuldigen | Iiiiiii |
lieb, brav „lieb, dass du das Spielzeug teilst“
„Nur wenn du lieb bist, darfst du später auf der Hochebene schlafen“
„lieb, dass du das Spielzeug teilst“
„Lieb“, „brav“ und „artig“ sind Bewertungen des kindlichen Verhaltens. Lieb sein oder auch artig sein assoziieren wir mit einem Kind, das unsere Erwartungen erfüllt, das nicht aufmuckt, immer hört und nicht widerspricht. Lieb sein meint, dass die Kinder positive Gefühle zeigen sollen und keine negativen wie Wut oder Ärger. „Nur wenn du lieb bist, darfst du später auf der Hochebene schlafen“. Lieb bedeutet auch, dass Kinder nicht in den Konflikt mit mir oder einem anderen Kind gehen: „lieb, dass du das Spielzeug teilst“ auch wenn sie etwas anderes in sich spüren. Wenn Kinder alle verlangten Aufgaben ohne Widerstand erfüllen, wenn alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, wenn Kinder nicht handgreiflich oder aggressiv werden oder in sonstiger Weise ein sozial unangemessenes Verhalten zeigen, dann bewerten wir ihr Verhalten als „lieb“. Mit braven Kindern ist vermutlich wirklich alles einfacher und funktioniert besser.
Das Problem dabei ist, dass Kinder dabei mehrere Botschaft erhalten, die für ihre sozial emotionale Entwicklung negative Folgen haben kann. Wenn sie immer wieder „lieb“ sein sollen, vermitteln wir ihnen, dass negative Gefühle wie Wut, Neid, Scham und Ärger nicht erlaubt sind: „sei lieb“. Das bedeutet unmittelbar, dass Kinder verstehen, „ich darf meine Grenze nicht deutlich machen“. Wenn dieses Empfinden über längere Zeit anhält, verlieren Kindern ihr Gefühl für Wut, Ärger, Widerstand und Abgrenzung. Immer brav und lieb sein ist allerdings schlicht nicht möglich weil wir ein natürliches Bedürfnis nach Abgrenzung, Autonomie und Selbstbestimmung haben. So kann es dazu kommen, dass die eigenen Gefühle verdrängt und somit die unerfüllten Bedürfnisse verleugnen werden. Kinder lernen auch, dass Konflikte nicht in Ordnung sind, sie sich besser anpassen, sich am Äußeren orientieren und weniger sich selbst vertrauen sollten. Auf lange Sicht ist ein solches Verhalten jedoch nicht gesund. Im Erwachsenenalter sind solche Verdrängungen und Verleugnungen von Bedürfnissen u.a. mit ursächlich für Depressionen oder Burnout.
In dem Artikel: „Wart ihr auch immer brav? Was brav sein für Kinder bedeutet“ findest du mehr dazu“
gut, richtig, super, schön, toll
Es handelt sich auch bei den Wörtern „gut“, „richtig“, „super“, „schön“ oder „toll“ um Bewertungen des kindlichen Verhaltens, wenn auch positiven Bewertungen. Im ersten Moment würde man sagen, ist doch ok, Kinder wollen doch Lob und Anerkennung?! Wenn ich dem Kind sage, dass es etwas schön oder toll macht, freut es sich sicher darüber. Manche Kinder sehnen sich sichtlich danach, Anerkennung und Lob zu bekommen:
- „genau, du hast deine Kleider richtig zusammengelegt, super!“
- „Oh, du hast eine schöne Burg gebaut!“
- „toll, wie du geholfen hast aufzuräumen!“
- „gut gemacht!“
- „du hast deine Schuhe wieder richtig in das Fach gestellt!“
Lasst uns aber nochmal genauer hinschauen: es handelt sich bei den beschriebenen Wörtern um Beurteilungen, die wir als Erwachsene aufstellen, um das kindliche Verhalten zu bewerten, ähnlich wie mit einer Schulnote. In diesem Moment stellen wir uns über das Kind, um ihm zu sagen, wie es sein soll, ob es ausreicht und das alles aus meiner Beurteilungswarte heraus. Es kommt die Botschaft an, ich sage dir, wie du dich verhalten musst, damit du gut und richtig bist. Wenn ich sage, du machst das zu dem Zeitpunkt auf diese Weise toll, dann wird das Kind versuchen, in diesen Momenten mir zuliebe wieder genau das Verhalten erneut an den Tag zu legen. Dadurch dass wir das Kind bewerten besteht keine Gleichwürdigkeit zwischen dem Kind und mir.
Bewertungen hängen unmittelbar mit dem Selbstwert des Kindes zusammen. Das bedeutet das Kind versteht nicht nur, das was ich gerade tue, gefällt dem anderen, sondern ich bin richtig und gut weil ich den Auftrag so ausgeführt habe, wie ich es wollte.
Das Kind orientiert sich im Außen und verliert – bei häufigem Lob – den Kontakt zu sich selbst, sucht die Bestätigung im Außen und kann sogar süchtig danach werden. Für ein glückliches Leben ist es also notwendig, sich selbst einen Wert geben zu können und Dinge zu tun weil ich sie tun möchte. Mit einer angeborenen inneren Motivation (intrinsische Motivation) tun Kinder das Anfangs für gewöhnlich auch bis wir es ihnen abtrainieren, sich selbst genug zu sein.
Aber Kinder brauchen doch Orientierung? Ja genau, Führung, Halt und Orientierung sind wichtige Bedürfnisse von uns Menschen. So orientiert sich ein Kleinkind an uns als Bezugspersonen, um zu wissen, in welchen Situationen es wie handeln soll. Ach, da soll ich jetzt lieber stehen bleiben, wenn ich mich so und so verhalte, reagiert meine Bezugsperson, als ob ich das lieber sein lassen sollte usw. Wir können unsere Anliegen jedoch anders transportieren als über Bewertungen, nämlich über eine Auskunft unseres tatsächlichen Innenlebens: wir können unsere Gefühle, Bedürfnisse und Anliegen Preis geben, die Bedürfnisse, Gefühle und Grenzen der anderen Kinder verbalisieren und Auskunft über das Seelenlebens des betroffenen Kindes geben.
Anstatt „den Turm hast du aber toll gebaut“, können wir sagen:
„du hast aber einen hohen Turm gebaut, ich habe dich beobachtet, da hast du ganz schön lange dran gesessen“
„du bist vermutlich ganz stolz darauf, dass du so einen hohen Turm gebaut hast oder?“
„und ich habe gesehen, dass Clara den Turm vorhin umgeworfen hat und du hast dich sofort daran gemacht, ihn wieder aufzubauen. Ich bin wirklich beeindruckt!“
Ich zeige, dass ich bemerkt habe, wie das Kind den Turm gebaut hat und erfülle damit das Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung. Oft reicht auch ein. Ich honoriere zusätzlich die Anstrengung des Kindes und gehe mehr auf das Tun ein als auf das Produkt. Anstatt einer Bewertung kann ich auch das Gefühl des Kindes eingehen. Denn im Grunde möchte das Kind keine Wertung sondern drückt sich lediglich mit seinem Gefühl aus: nämlich Stolz. Durch die Verbalisierung des Gefühls gebe ich dem Kind Informationen darüber, wie es in ihm aussieht. Es lernt dadurch Selbsteinfühlung. Ich kann auch etwas über meine Gefühle erzählen: „ich freue mich mit dir“ „ich bin beeindruckt“ „ich freue mich wie stolz du bist“.
wenn ich sage, „du hast heute schön gegessen!“ bewerte ich das Kind von außen in seinem Essverhalten und nehme direkten Einfluss darauf. Diese Aussage ist jedoch auch sehr schwammig, denn was bedeutet es genau schön zu essen? Geht es um die Menge des Essens? War es zu viel? War es zu wenig? Oder ging es um das Verhalten des Kindes während des Essens? Es ist nicht klar, was mit „schön“ an der Stelle gemeint ist und das verunsichert Kinder sehr.
Anstatt „du hast schön gegessen“ können wir sagen:
„ich habe beobachtet, dass es dir geschmeckt hat“
„es war mir eine Freude zu beobachten, mit welcher Wonne du gegessen hast!“
Durch Bewertungen von außen lernt das Kind, ich bin richtig, ich bin gut, ich bin toll weil ich versucht habe, etwas so zu tun, wie meine Erzieherin es wollte.
falsch „das hast du falsch gemacht“
„das hast du falsch ausgeschnitten“
„du hast die Schuhe falsch an“
„du hast die Jacke falsch angezogen“
Auch hier handelt es sich um eine Bewertung des Kindlichen Verhaltens, allerdings um eine negative, die für das kindliche Selbst noch belastender sein kann als die positiven Bewertungen (s.o.). Auch hier ist es so, dass das Verhalten von außen durch einen normierten Maßstab bewertet wird. Je nach Häufigkeit dieser negativen Bewertung kann eine direkte Auswirkung auf den Selbstwert des Kindes wahrgenommen werden. Es kann sein, dass das Kind lustlos wird, demotiviert ist, Selbstzweifel entwickelt und innere Glaubenssätze wie: „ich mache eh alles falsch“ „nichts kann ich richtig machen“ aufbaut, die es für sein gesamtes Leben prägen.
Anstatt im Negativmodus zu verharren und das Augenmerk darauf zu legen, was falsch läuft, können wir unseren Fokus auf die Fähigkeiten des Kindes legen. Wir können die Ressourcen des Kindes betrachten und es darin bestärken. Wir können also die Perspektive verändern und mit positiver Haltung und in positiver Sprache auf das Wort „falsch“ verzichten. Wir können formulieren, was wir von dem Kind erwarten, über die Fehler hinwegsehen oder sogar die Fehler feiern (so wird es in Neuseeländischen Schulen praktiziert).
Anstatt „das hast du falsch ausgeschnitten“ können wir sagen:
„genau, schneide auf der Linie entlang“ oder einfach drüber hinwegsehen. Der Stolz und die Selbstwirksamkeit ist ein wichtigerer Wert als das korrekte Ausführen von Aufgaben.
Anstatt „du hast die Jacke falsch angezogen“ können wir sagen:
„schau mal der Ärmel hängt da unten. Hier kannst du reinschlüpfen“. Der Fokus liegt dann nicht mehr auf dem Fehler sondern auf der konkreten Unterstützung. Wir können das Kind jedoch auch mit der verdrehten Jacke rausgehen lassen und erst helfen, wenn es danach fragt.
Fehlerfreundlichkeit zu üben ist enorm wichtig. Für ein glückliches Leben brauchen wir das Wissen, dass wir nicht alles perfekt machen können und müssen. Es ist erlaubt Fehler zu machen, wir brauchen uns selbst nicht zu verurteilen, wenn wir Dinge nicht so gut konnten oder vermeintlich falsch gemacht haben. Wir können den Kindern dadurch vermitteln: du tust das beste was du kannst und das reicht aus! Fehler dürfen sein, du darfst freundlich mit dir selbst umgehen!“ Nur wenn wir in „Fehlermomenten“ freundlich mit den Kindern umgehen, können sie auch für sich integrieren: „ich darf freundlich zu mir sein auch wenn ich etwas nicht so gut kann“
böse „du haust andere, du bist böse“
„du schubst andere, das ist böse“
Wenn wir das positive Menschenbild Carl Rogers oder Marshall Rosenbergs betrachten, können wir sagen, alle Menschen sind gut, jeder tut in jedem Moment sein Bestes und jeder handelt so, wie er Strategien an der Hand hat, um sich unerfüllte Bedürfnisse zu erfüllen. „Böse“ ist eine Bewertung des Gegenübers, die dazu noch äußerst negativ ist. Wenn wir einen Menschen oder seine Handlungen als „böse“ bewerten, ist das eine Herabwürdigung, die weitreichende Folgen für den Selbstwert des Gegenübers haben kann.
Wenn wir einem Kind sagen, es sei „böse“ kann es diesen Glaubenssatz sein gesamtes Leben mit sich tragen. Diese Gedanken können in Selbstvorwürfen und Autoaggression münden, sowie sich unmittelbar in den Handlungen des Kindes ausdrücken z.B. auch durch aggressives Verhalten.
Mit dem Satz „du haust andere. Das ist böse“ wollen wir doch eigentlich ausdrücken, dass das Kind eine Verhaltensweise zeigt, die nicht sozial angemessen ist und wir uns wünschen, dass das Kind anders handelt, damit Kinder nicht verletzt werden. Das bedeutet, das Kind Kind braucht unsere Unterstützung, um sein Handeln zu verstehen und alternative Handlungsstrategien zu entwickeln.
Anstatt zu sagen „du haust andere. Das ist böse“ können wir sagen:
„Stopp, gehauen wird nicht! (schützende Grenze setzen) Du bist gerade ziemlich wütend weil du auch auf dem Platz sitzen wolltest (Bedürfnis benennen). Du kannst die Kathrin fragen, ob du auf diesem Platz sitzen darfst (Alternative Handlungsweise erarbeiten). Oder hast du eine andere Idee?“
nicht „fall nicht!“
„mache nicht die Füße auf den Tisch“
„nicht den Tom umfahren!“
„du sollst nicht hauen“
Positive Sätze kann das kindliche Gehirn deutlich besser aufnehmen, verstehen und verarbeiten als negierende Sätze mit einem „nicht“. Wenn wir sagen: „denk nicht an den rosa Elefanten!“ denken wir erst recht an den rosa Elefanten oder?
Deshalb dürfen wir Negativ-Sätze mit „nicht“ in positive Sätze umwandeln. Dadurch wissen Kinder besser, was wir meinen, was wir von ihnen erwarten und welche alternative sozial angemessene Handlungsweisen sie anwenden können.
Anstatt zu sagen: „mach nicht die Füße auf den Tisch“ können wir sagen:
„Lass die Füße unterm Tisch!“
Anstatt „nicht den Tom umfahren!“ können wir sagen:
„Fahre an Tom vorbei!“
Anstatt zu sagen: „du sollst nicht hauen“ können wir sagen:
„Stopp, behalte die Hände bei dir!“ oder „Stopp! Wenn du den Stift haben möchtest, frage den Lukas!“
Man “das macht man nicht”
„man haut nicht”
„man spielt nicht mit dem Essen”
„wie sagt man?“
Wer ist eigentlich dieser „Man“? Irgendein großer Unbekannter, der weiß wie wir uns verhalten sollen? Durch das Wörtchen „man“ tun wir so, als gäbe es eine unbekannte Person, einen moralischen Grundsatz, an den wir uns zu halten hätten, allgemeine Regeln, die für alle gelten, die der „man“ aufgestellt hat. Sehr seltsam. Durch das Wort „man“ wird die verbale Interaktion unpersönlich und es übernimmt keiner die Verantwortung. Das einzige, was wir beim Kind auslösen können, ist Angst vor dem ominösen „Man“, den keiner kennt.
Was können wir anstatt dessen sagen? Wir dürfen das Wörtchen „man“ durch „Ich“ ersetzen und übernehmen damit die Verantwortung für unser Gesagtes, unsere Haltung, unsere Werte und unsere Bedürfnisse. Dadurch teilen wir uns ehrlich mit und können beim Kind so Empathie und Verständnis hervorrufen.
Anstatt „man haut nicht“ könnte ich sagen:
- „Stopp, ich will nicht, dass du haust!“
- „Stopp, behalte die Hände bei dir!“
- „du ärgerst dich gerade sehr weil du auch gerne rutschen willst, stimmt’s?“
Beim Satz „man spielt nicht mit dem Essen!“ kann ich mich erstmal fragen, warum möchte ich das eigentlich nicht? Weil mein Bedürfnis nach Ordnung und Sauberkeit verletzt ist oder weil ich einen Glaubenssatz von „weil man das nicht macht“ in mir trage? Dann reflektiere genau, woher dieser Glaubenssatz kommt und ob du ihn so beibehalten möchtest. Wenn dir die Sauberkeit wichtig ist, könntest du sagen :
Anstatt „man spielt nicht mit dem Essen!“ könnte ich sagen:
„behalte deine Nudeln auf dem Teller! Ich möchte, dass der Boden sauber bleibt!“
Beim Satz „wie sagt man?“ sollen die Kinder für Gewöhnlich dazu angehalten werden, sich zu bedanken. Diesen Satz können wir insgesamt ablegen weil Kinder erst sehr spät den Wert Dankbarkeit zu verstehen. Sie beginnen erst mit vier Jahren die Perspektivenübernahme zu entwickeln und können sich davor nicht in andere Menschen hineinversetzen. Das bedeutet, wenn wir aus erzieherischen Maßnahmen heraus den Kindern beibringen, „man sagt danke“ werden sie das lernen aber nur Floskel artig dahersagen ohne zu wissen, was sich dahinter verbirgt. Das ist ähnlich wie beim Thema „Entschuldigen“ (s.u.).
Auf den Satz „wie sagt man?“ kann ich gänzlich verzichten, da es den „Man“ nicht gibt und ich lediglich meine Verantwortung an etwas/ jemanden anders abgeben möchte. Wenn es mir wichtig ist, mich zu bedanken, kann ich das anstatt des Kindes tun. Dann übernehme ich die Verantwortung für meinen Wunsch Dankbarkeit ausdrücken zu wollen und nicht das Kind. Durch unser Vorbild lernen Kinder früh genug „Danke“ zu sagen. Da dürfen wir den Kindern vertrauen.
Memme, Macker, Trampel, Prinzessin, Zicke, Diva
Jedes dieser Worte sind beurteilende Zuschreibungen, die mit bestimmten negativen Verhaltensweisen assoziiert werden: eine Memme ist weinerlich, der Macker ist laut und sich selbst darstellend, der Trampel tut anderen weh weil er nicht aufpasst und macht Sachen kaputt, eine Prinzessin lässt sich bedienen, die Zicke will vieles nicht, sagt oft „nein“ und die Diva ist arrogant. All das sind vorurteilsbezogene Beurteilungen, die wir Kindern auferlegen, wenn wir sie so nennen. Diese Worte beschreiben meistens Eigenschaften, die negativ sind und Kinder in eine Schublade stecken, sie werden stigmatisiert. Dadurch kann es auch zu einer Selbststigmatisierung kommen, die es den betroffenen Kindern schwer macht, anders über sich zu denken als im Rahmen der Zuschreibung. „Ich bin eine Memme, ich weine immer!“.
Wir Fachkräfte nutzen die zuschreibenden Worte wie Memme, Zicke usw., um die Verantwortung für eine unsichere Situation und starke Gefühle von uns weg den Kindern zu übergeben. „Wenn Lukas ein Macker ist, kann ich da als Fachkraft wenig machen!“, „Jenny ist halt eine Memme, da kann man nichts machen!“.
Jedes Kind kommt mir unterschiedlichem Temperament, unterschiedlichen Erfahrungen und Hintergründen in die Kindertageseinrichtungen. Unser Aufgabe als Fachkraft ist es die einzelnen Kinder mit ihren individuellen Wesen wahrzunehmen, zu begleiten und die Schätze an den Tag bringen. Wenn wir sie immer wieder in eine Ecke drängen, haben sie kaum eine Chance aus ihr herauszukommen. Das bedeutet, sie glauben irgendwann selbst, sie seien eine Memme, ein Macker oder eine Zicke.
Mäußchen, Süße, Püppi, Schätzchen
Wir verwenden in pädagogischen Einrichtungen häufig Kosenamen wie „Mäußchen“, „Süße“, „Püppi“ und „Schätzchen“. Es rutscht uns so raus, die Kleinen sind ja auch zu süß. Viele denken, Kinder mögen es, so benannt zu werden. Auf diese Art schaffe ich es doch Nähe zu den Kindern aufzubauen oder? Das Gegenteil ist oft der Fall. Für viele Kinder handelt es sich bei der Liebkosung mit Kosenamen um eine Grenzüberschreitung. Wenn wir sie fragen ob sie so benannt werden wollen, antworten die meisten Kinder mit Nein. Verständlich, denn wir behandeln sie in dem Moment, als wären sie ein Kuscheltier, etwas Kleines, Niedliches, ein Objekt, das liebkost wird.
Kinder wollen jedoch GLEICHWERTIG als vollwertige Persönlichkeiten gesehen werden, als Subjekte, die ihr Leben selbst gestalten können, die über sich selbst bestimmen können. Sie wollen als Karl, Louis, Mia, Fred und Emma gesehen und geschätzt werden und nicht als kleine süße Püppchen behandelt oder wie Objekte betätschelt werden. Sie wollen wie sie SELBST behandelt werden – mit all ihren Interessen, Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften.
Wir können Kinder FRAGEN, ob sie die Liebkosungen mögen. Manche Kinder verlangen vielleicht sogar danach. Wenn sie ihr Einverständnis dafür geben, sind die verniedlichenden Bezeichnungen keineswegs zu kritisieren. Aber wenn Kinder sie nicht mögen, sollten wir sie sein lassen. Und wenn uns doch eine gut gemeinte Liebkosung über die Lippen rutscht, haben wir die Möglichkeit unser BEDAUERN darüber auszudrücken.
“Oh ich weiß, eigentlich magst du so nicht genannt werden. Ich bedauere, dich “Mäuschen” genannt zu haben weil ich weiß, dass du das nicht magst. Ich versuche nächstes Mal darauf zu achten, denn mir ist es wichtig, dass deine Grenzen respektiert werden”
Im Artikel: „Na Süße… wenn Fachkräfte Kinder mit Worten liebkosen“ kannst du mehr dazu lesen.
Entschuldigen („entschuldige dich!“)
„entschuldige dich!“
„Entschuldigung, dass ich vorhin nicht mehr zu dir gekommen bin“
Das Wort „Entschuldigen“ enthält das Wort „Schuld“. In Rosenbergs positivem Menschenbild gibt jeder Mensch in jedem Moment sein Bestes und möchte zum Wohle der Gemeinschaft beitragen. Es kann also keinen Schuldigen geben, nur Menschen, die Strategien anwenden um sich Bedürfnisse zu erfüllen. Kein Mensch macht etwas falsch oder trägt gar die Schuld für etwas, das er getan hat, sondern verwendet ihm verfügbare Strategien, um sich seine unerfüllten Bedürfnisse zu erfüllen. Es kann sein, dass die gewählten Strategien sozial unangemessen sind und der Mensch in dem Moment keine passenden Strategien zur Verfügung hat. Kinder haben entwicklungsbedingt oft noch keine Strategien zu Hand, die wir als angemessen ansehen würden (Hauen, Beißen, Schubsen usw.). Sie tragen dadurch keine Schuld und brauchen unsere Unterstützung.
Aus den genannten Gründen ist es weder nötig, dass Kinder sich entschuldigen, noch ist es notwendig, dass wir als Erwachsene uns für unser Verhalten bei den Kindern entschuldigen. Keiner trägt die Schuld an einem entstandenen Konflikt.
Was wir aber tun können, ist unser Bedauern darüber ausdrücken, dass wir nicht so gehandelt haben, wie wir es uns selbst gewünscht hätten. Wir haben gegen unsere Werte gehandelt und wollen das dem Kind deutlich machen.
Anstatt „Entschuldigung, dass ich vorhin nicht mehr zu dir gekommen bin“ kann ich sagen:
„ich bedauere sehr, dass ich vorhin nicht mehr zu dir gekommen bin obwohl ich es versprochen hatte. Mir ist es wichtig Versprechungen einzuhalten. Ich versuche mich nächstes Mal daran zu halten. Vielleicht kannst du mir auch dabei helfen?“
Anstatt mit einem „entschuldige dich!“ eine Entschuldigung zu erzwingen, kann ich mit den Kindern darüber ins Gespräch gehen, was sie dazu bewegt hat, so zu handeln. Ich kann den Kindern helfen ihre Gefühle zu verstehen und ihre Bedürfnisse zu begreifen. Auf diese Weise ermögliche ich den Kindern, sich in den anderen hineinzuversetzen und zu verstehen, dass der andere nicht aus böser Absicht gehandelt hat, sondern weil er ein Bedürfnis hatte. Kinder lernen dadurch echte Empathie und keine erlernte leere Floskel.
Wir dürfen Vertrauen in die Kinder haben, dass sich ihr Mitgefühl mit der Zeit entwickeln wird. Kinder lernen ihr Mitgefühl und ihr Bedauern auszudrücken, wenn sie kognitiv und emotional in der Lage dazu sind. Wir Erwachsenen können den Kindern das Trösten, gegenseitige Helfen und Bedauern vorleben.
Au Weia, Oh oh: „au weia hör sofort auf“
„oh oh (mahnend) hör auf den Pepe zu hauen“
„au weia Lisa“
Der Ausruf „Au Weia“ und „Oh oh“ werden oft in Zusammenhang mit einer Mahnung ausgesprochen. Es ist hier gemeint, wenn wir mit der Wortnutzung ein Fehlverhalten eines Kindes kommentieren.
Die Worte „au weia“ und „oh oh“ können je nachdem welchen Tonlaut ich verwende, äußerst bedrohlich wirken und Kindern Angst machen. Ich habe in Kitas häufig beobachten, wie Kinder förmlich zusammenzucken, wenn Fachkräfte ihr Handeln mit diesen Lauten kommentieren. In den Gesichtern der Kinder war zu lesen: „oh Gott, ich habe etwas falsch gemacht“. Es schließt sich wiederum die Übertragung an, dass das Kind nicht nur hört: „ich habe etwas falsch gemacht“, sondern „ich bin falsch“ und überträgt es direkt auf seinen Selbstwert (Lies dazu auch gerne weiter oben zum Wort „falsch“). Wenn die Lautäußerungen durch die Fachkräfte „Au Weia“ oder „Oh oh“ ohne weitere Erklärungen im Raum stehen bleiben, geraten die Kinder zusätzlich in einen Zustand großer Verunsicherung. Sie wissen nicht, was sie genau falsch gemacht haben.
Anstatt „oh oh hör auf den Pepe zu hauen“ können wir sagen:
„Stopp. Aufhören zu hauen! (schützende Grenze, wenn notwendig auch liebevoll körperlich einschreiten). Du willst die Puppe haben, mit der Pepe gerade spielt oder? (Bedürfnis benennen). Schau mal, wir haben hier noch eine Puppe. Dann kannst du gemeinsam mit Pepe und dem Puppenwagen fahren“ (Lösungsvorschlag).
Anstatt „au weia Lisa“ (sie geht aus der Tür raus, was sie nicht soll) können wir sagen:
„Bleib hier Lisa!Was suchst du denn draußen? Wolltest du nach den anderen Kindern gucken? Wollen wir mal gemeinsam schauen gehen?„
Versuchen wir also die Ausdrücke „Au Weia“ und „Oh oh“ aus unserem Wortschatz zu streichen weil sie auf Kinder bedrohlich wirken und ihnen keine Möglichkeit gibt, zu verstehen, was sie tun können.
Gleich „ich komme gleich“
Kindergartenkinder leben im Hier und Jetzt. Sie haben kaum eine Zeitwahrnehmung. Diese beginnt bei Kindern erst zwischen drei und sechs Jahren. Das bedeutet Zeitangaben sind generell eine schwer greifbare Größe für Kinder. Wenn wir sagen: „gestern“, „morgen“, „letzte Woche“, „gerade eben“ usw. haben Kindergartenkinder meist noch keine wirkliche Vorstellung davon, was wir damit meinen und vor allem wie lang es sich genau anfühlt. Das Zeitempfinden ist bei uns Menschen sowieso höchst unterschiedlich und sehr subjektiv. Der eine empfindet eine bestimmte Zeitspanne als lang, der andere als kurz.
Neben dem noch wenig ausgeprägten Zeitempfinden ist die Zeitangabe „gleich“ oder auch „bald“ sehr schwer greifbar. Sie ist sehr unklar und schwammig. Was bedeutet „gleich“? Wie lange ist „gleich„? Manchmal kommt die Erzieherin sofort wenn sie „gleich“ sagt, manchmal dauert es länger und manchmal kommt sie auch gar nicht. Es ist für Kinder und im übrigen auch für Erwachsene, schwer nachvollziehbar, was wir mit „gleich“ meinen. Wann ist denn „gleich“?
Das Wort „gleich“ dürfen wir also aus unserem Wortschatz streichen und durch genaue (Zeit-)Angaben ersetzen:
„wenn ich mein Brot aufgegessen habe, komme ich zu dir, versprochen!“
„wenn der große Zeiger oben ist, dann komme ich aus der Pause wieder“
„wenn wir geschlafen und gevespert haben, dann kommt deine Mama wieder und holt dich ab“
Unsere Versprechen sollten wir dann unbedingt einhalten, sonst lernt das Kind, dass Warten sich nicht lohnt und es sich auf die Erzieherin nicht verlassen kann. Das zeigt auch der berühmte Marshmallow-Test. Kinder warten dann häufiger und länger, wenn die Belohnung eines zweiten Marshmallows auch eintritt. Wenn die Belohnung ausbleibt, warten sie nicht mehr und essen den Marshmallow schnell auf.
Aber „Du willst noch weiterspielen aber wir gehen jetzt raus“
- „ja super machst du das, aber du musst noch aufräumen“
- „ich verstehe, dass du toben möchtest aber jetzt ist Ruhezeit!“
Wenn wir das Wort Aber“ benutzen, drücken wir eine vermeintliche Akzeptanz des kindlichen Bedürfnisses aus. Es handelt sich jedoch nur um eine Pseudoakzeptanz, denn wenn wir uns einen Aber-Satz genau anhören, merken wir, alles was vor dem „Aber“ steht, wird weggewischt, also ungültig. Das Bedürfnis des Kindes zählt dann nicht mehr und nur das eigene steht im Mittelpunkt.
Damit drücken wir aus, dass unsere Meinung, unser Bedürfnis wichtiger sei als das des Kindes. Das Wörtchen „Aber“ ist also ein Verbindungskiller, es sorgt dafür dass die Verbindung verloren geht und behindert den echten Dialog.
Anstatt das Wort „Aber“ zu verwenden, können wir die Wörter „und“ oder „gleichzeitig“ benutzen. Denn sie zeigen, dass die Bedürfnisse beider Parteien relevant sind und nebeneinander existieren dürfen. Dadurch schätzen wir beide Bedürfnisse und damit beide Menschen des Konflikts wert.
Anstatt „du willst noch weiterspielen aber wir gehen jetzt raus“ könntest du sagen:
„du möchtest gerne hier drinnen bleiben weil du deinen Turm fertig bauen willst. Gleichzeitig wollen die anderen Kinder alle raus und ich möchte die anderen Kinder beaufsichtigen“
Anstatt „ich verstehe, dass du toben möchtest aber jetzt ist Ruhezeit!“ könntest du sagen:
„du brauchst gerade viel Bewegung und die anderen Kinder wollen sich gerade ausruhen, sie brauchen Ruhe“
Immer: „Immer musst du andere ärgern“
- „immer lässt du deinen Teller stehen!“
- „immer schmeißt du deine Schuhe auf den Boden!“
Kein Mensch zeigt immer ein bestimmtes Verhalten. Das ist schlicht unwahr und eine Übertreibung. Mit dem Wort „immer“ formulieren wir negative Erwartungen und manchmal auch unbewusste Stigmatisierungen.
Wir nutzen das Wort „immer“, um unserer Haltung Nachdruck zu verleihen und unseren Ärger auszudrücken. Gleichzeitig werten wir dadurch das Kind jedoch ab. Es ist sehr verletzend, wenn eine andere Person davon ausgeht, dass ich immer das gleiche negative Verhalten zeige.
Deshalb dürfen wir das Wort „immer“ aus unserem Wortschatz streichen. Wir können den Fokus auf Positives lenken und unsere eigene Wahrnehmung schulen. Ist das wirklich so, dass das Kind immer dieses Verhalten zeigt? Wie häufig kommt das Verhalten wirklich vor? Ich kann auch Strichlisten dazu führen. Dann stelle ich wahrscheinlich sehr schnell fest, das Kind zeigt das Verhalten viel seltener, als ich es selbst angenommen habe und „immer“ wird der Beschreibung in keinem Fall gerecht.
Was wir nicht vergessen dürfen ist, dass Verhalten von Kindern sich oft auch genau auf die Weise zeigt, wie wir es erwarten. Gemäß dem Motto self-fulfilling-prophecy.
Anstatt das Kind mit „immer“-Sätzen herabzuwürdigen, können wir den Fokus darauf lenken, was gut läuft. Das Kind z.b. Beim gut Sein erwischen. Wir können beobachten, wann das Kind genau das Verhalten an den Tag legt, das ich mir wünsche. Wir können den Fokus darauf lenken, in welchen Momenten das Kind korporiert und zugewandt ist. Dann können wir darüber unsere Freude ausdrücken.
„Ich habe gesehen, du hast deine Schuhe gerade eben direkt in das Regal gestellt. Darüber freue ich mich sehr!“
Wir können auch unsere Erwartungen formulieren. In einer ruhigen Minute im Vieraugengespräch können wir sagen:
„ich wünsche mir, dass du nach dem Essen deinen Teller auf den Wagen stellst!“
Ordentlich: „setz dich ordentlich hin“
- „Stell die Kiste ordentlich in das Regal!“
- „Stell den Stuhl ordentlich an den Tisch!“
- „Räume ordentlich auf!“
das Wort ordentlich ist sehr unkonkret und unspezifisch. Wenn wir dem Kind sagen, es soll etwas ordentlich tun, weiß es immer noch nicht, was es genau tun soll. „Ordentlich“ ist eine unklare Aussage, bei der der Handlungsauftrag nicht klar ersichtlich ist. Das verunsichert ungemein. Das Kind weiß nicht, was es tun soll, um die Fachkraft zufrieden zu stellen.
Anstatt „setz dich ordentlich hin!“, können wir sagen:
- „zieh den Stuhl an den Tisch ran“
- „nimm das Besteck in die Hand“
- „halte deine Beine stimm“
Anstatt „räum ordentlich auf“, können wir sagen:
- „nimm die Kiste mit den Legosteinen und stell sie neben die grüne Kiste“
Es ist also wichtig, dass wir klare Sätze formulieren, bei denen die Kinder genau wissen, was wir meinen. Das Wort „ordentlich“ lässt viel Raum für Spekulationen und Interpretation. Das verunsichert Kinder. Sie brauchen unsere ganz konkrete Anleitung.
Sollen, Müssen „du musst noch deine Sachen aufhängen“
- „du musst noch die Bauklötze einräumen“
- „das musst du lernen“
- „du musst dich entschuldigen“
Bei dem Wort „muss“ oder „müssen“ baue ich automatisch Druck auf den Adressaten auf. Und Druck erzeugt ja bekanntlich Gegendruck. Auch wenn wir unseren Worten durch dadurch Nachdruck verleihen möchten, erzielen wir das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen, nämlich Abwehr und Trotz.
Ihr könnt dazu mal ein Experiment mit euren Freunden, Arbeitskollegen oder Partnertnern durchführen. Nutzt in Gesprächen immer wieder das Wort „müssen“ oder „muss“ und beobachtet die Reaktionen der anderen. „Du musst noch den Müll rausbringen!“ „du musst noch den Gruppenraum fegen!“. Ihr könnt euch denken, wie eure KollegInnen reagieren würden.
Wenn wir einem Kind etwas auferlegen, in dem wir das Wort „müssen“ verwenden, unterliegt es einer Pflicht, einem Gehorsam. Weil wir Menschen jedoch Wesen sind, die das Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Autonomie haben, kommt eher Wut und Ärger auf, um die eigene Autonomie wiederzuerlangen und sich nicht ausgeliefert zu fühlen.
Das, was wir sagen, wird zur inneren Stimme der Kinder. Wenn Kinder schon früh mit den Wörtern sollen und müssen konfrontieren, kann das dazu führen, dass sie eine sehr kritische innere Stimme von „müssen“ entwickeln, die immer wieder von innen Druck auf sie ausübt.
Wir können das Wort „Sollen“ und „Müssen“ durch die direkte Verwendung des Verbs vermeiden. Wir können aber auch dürfen oder können verwenden.
- du darfst
- du kannst
- du hast die Chance.
- du hast die Möglichkeit.
- du kannst dich entscheiden
Anstatt „müssen“ zu verwenden, können wir auch klare eigene Erwartungen formulieren darüber, was wir brauchen und was unser Bedürfnis ist.
- „ich bitte dich, deine Jacke an den Haken zu hängen!“
- „ich will, dass du die Jacke an den Haken hängst, damit wir nachher genügend Platz hier in der Garderobe haben und nicht auf die Jacke treten“
Auch ich selbst darf freundlich mit mir sein und mir selbst kein „müssen“ oder „sollen“ auferlegen. Dadurch bin ich ein gutes Vorbild für die Kinder. Wie oft sagen wir: „ich muss noch…“ und „dann muss ich noch …“
Wenn… dann: „wenn du nicht aufräumst, gibt es kein Mittagessen“
„Wenn du jetzt nicht den Joe in Ruhe lässt, setze ich dich weg“
„wenn du nicht sofort herkommst, brauchst du nicht mehr anzukommen“
Die Wenn…dann-Drohung ist in unserer Erziehung noch immer vielerorts ein verbreitetes Erziehungsmittel. Sie funktioniert auch. Allerdings ist vielen nicht bewusst, welche emotionalen Auswirkungen diese kleine Satzzusammensetzung bei Kindern bewirken kann.
Durch die Wenn…dann Drohung nutzen wir das Mittel der Angst um Kinder zu dem Verhalten zu bringen, das wir von ihnen wollen. Es handelt sich also um eine Form der Manipulation. Nur wenn das Kind sich so verhält wie ich es will, erhält es das, was es braucht. Wir knüpfen unsere Unterstützung zur Bedürfniserfüllung des Kindes also an Bedingungen. Wir helfen nur, wenden uns nur zu, geben ihnen nur Nähe, erfüllen ihr Bedürfnis nach Nahrung nur, wenn sie meine Erwartungen erfüllen. Kinder lernen so, nur wenn ich so bin, wie es meine Erzieherin/ mein Erzieher von mir verlangt, gibt er/sie mir das, was ich eigentlich brauche. Es entsteht ein ungesundes Abhängigkeitsverhältnis und das Kind verliert das Gefühl für sich und seine eigenen Bedürfnisse.
Als Erwachsene haben wir jeder Zeit die Möglichkeit uns selbst unsere Bedürfnisse zu erfüllen z.B. nach Essen, Trinken, auf Toilette gehen und tun dies für gewöhnlich auch prompt. Wenn wir uns unsere Bedürfnisse nicht sofort erfüllen können, werden wir unruhig und ungehalten. Kinder hingegen sind von uns abhängig und brauchen unsere Unterstützung, um sich ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn die eigene Not dann nicht gesehen wird und ihre Bedürfniserfüllung von bestimmten Voraussetzungen abhängt, können Kinder in echte Verzweiflungsmomente geraten, aus denen sie selbst nicht herauskommen können.
Wenn…dann- Sätze enthalten meist Negationen, die das kindliche Gehirn nur schwer verarbeiten kann. Das Kind erhält nur eine Botschaft darüber, wie es sich nicht verhalten soll aber keine darüber, wie es sich verhalten soll (siehe oben beim Wort „nicht“).
Wir verwenden oft „wenn…dann“-Sätze, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wir in einer Ohnmacht gefangen sind, uns hilflos fühlen, keine Möglichkeit zur Hand haben, die Situation anders zu lösen. Eigentlich wollen wir so nicht mit den Kindern sprechen, wissen aber nicht, was wir anstatt dessen tun sollen. Gegenüber unserem Partner oder unseren Freunden würden wir vermutlich niemals eine solche „wenn… dann“ Drohung verwenden, gegenüber den Kindern scheint es jedoch noch Gang und Gäbe zu sein.
Was können wir nun tun? In diesem Fall gibt es keine einfachen alternativen Sätze, die wir verwenden können. Vielmehr handelt es sich um eine grundsätzliche Entscheidung, ob ich machtvoll und manipulativ handeln möchte oder nicht. Wenn ich mich dagegen entscheide, braucht es viel Reflexionsarbeit und Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie um eigene Triggerpunkte und innere Glaubenssätze verstehen und verändern zu können. Warum bringt mich genau diese eine Situation immer wieder so auf die Palme, dass ich mich so ohnmächtig fühle? Was hat das mit mir selbst zu tun? Habe ich in diesem Zusammenhang Kränkungen erlebt? Für jede Situation, in der wir wenn…dann Drohungen benutzen gibt es individuelle Lösungen. Ich versuche nun Lösungsansätze für das obige Zitat mit dem Aufräumen zu finden, die in der einzelnen Situation eventuell jedoch andere Lösungen braucht. Ein effektiver Weg ist jedoch immer wieder die Bedürfnisse, Gefühle und Grenzen des Kindes im Blick zu haben und meine Bedürfnisse dabei auch nicht aus den Augen zu verlieren.
Anstatt zu sagen „wenn du nicht aufräumst, gibt es kein Mittagessen“ können wir sagen:
„Ich wünsche mir, dass wir alle zusammen aufräumen, damit wir morgen hier wieder gemeinsam spielen können. Wenn wir alle kräftig mithelfen, sind wir schneller fertig und wir können uns an den Mittagstisch setzen“
„du willst nicht mit aufräumen, stimmt’s? Du findest das lästig? Hast du schon so dolle Hunger, dass du nicht mehr mithelfen kannst?“ (Wir dürfen auf Spurensuche gehen, was das unerfüllte Bedürfnis des Kindes ist, warum es nicht mithelfen kann und will)
Wir dürfen uns vor Augen halten, dass Aufräumen ein Bedürfnis von uns Erwachsenen ist. Die wenigsten Kinder haben das Bedürfnis nach Ordnung im Sinne von Aufräumen. Viele Kinder überfordert es schlicht, wenn viele Dinge im Raum liegen, sie zu sortieren und ordnungsgemäß an ihren Platz zu bringen. Wir können die Kinder dann im wahrsten Sinne des Wortes an die Hand nehmen und sie detailliert anleiten „du bringst die Puppen in die Puppenecke und du sammelst alle blauben Dinge zusammen“. Wir können also spielerische Elemente einbauen.
Es ist grundsätzlich wichtig, dass wenn Kinder sich weigern mitzuhelfen, ihr „Nein“ respektiert werden sollte. Lies dazu auch gerne den Artikel „Nein sagen dürfen“. Wir können unser Bedürfnis zwar deutlich machen, die Kooperation des Kindes können wir allerdings nicht erzwingen und müssen wir auch nicht. Wenn die Sorge tatsächlich eintritt, dass dann kein Kind mehr mithilft, was relativ unwahrscheinlich ist, gibt es ein neues Problem, das einer neuen Lösung bedarf. Die Spielsachen liegen rum und das Spielen ist nicht mehr möglich. Das ist dann die natürliche Konsequenz. Eine Lösung kann gemeinsam in der Gruppe erarbeitet werden. Ich als Fachkraft bin dann nicht in der Verantwortung alles alleine aufzuräumen, wenn ich das nicht will. Anstatt dessen kann ich die Kinder dazu anregen, eine gemeinsame, kreative Lösung zu finden. Dabei lernen die Kinder enorm viel: Empathie, Gemeinschaftssinn, Kreativität, Problemlösungsstrategien zu entwerfen uvm. Wenn wir nur sagen: „wenn du nicht mithilfst, dann bekommst du kein Mittagessen“ hingegen hinterbleibt beim Kind die Botschaft: der Mächtigere gewinnt, ich muss mich unterwerfen, wir können andere manipulieren, mein Bedürfnis zählt nicht, ich werde mit meinem Bedürfnis und meiner Angst nicht gesehen usw.
Vorsichtig „bitte lauf vorsichtig“
„Vorsicht an der Straße“
„Vorsichtig essen, sonst fällt das Essen runter“
„vorsichtig beim klettern“
Aussagen wie diese sind inhaltlich schwer zu greifen und bleiben sehr unkonkret. Für Kinder ist nicht nachvollziehbar, was mit dem Wort „vorsichtig“ genau gemeint ist. „Lauft vorsichtig“ trifft keine genaue Aussage darüber, wie Kinder anstatt dessen laufen sollen. Anstatt „vorsichtig“ braucht es an der Stelle die Formulierung einer exakten Erwartung durch die Fachkraft. Anderenfalls fällt es den Kindern schwer, die Erwartung im Kopf der Fachkraft zu erfüllen.
Anstatt „bitte lauf vorsichtig“ könnte ich je nach Situation sagen:
„bleib auf dem Weg!“ oder „lauft um die spitzen Steine herum“
„Vorsicht sonst fällst du“ enthält bereits eine Annahme, die die Fachkraft getroffen hat, was passieren könnte. Durch die ausgedrückte Unsicherheit und Angst der Fachkraft überträgt sich die Unsicherheit auf das Kind weil es die Reaktionen der Fachkräfte als Orientierung nutzt. Mit dieser Aussage wird das Kind also unnötig stark verunsichert und eine Verletzung wird dadurch viel wahrscheinlicher, denn das kindliche Gehirn nimmt diese Aussage unter Umständen als Aufforderung wahr.
Anstatt „Vorsicht sonst fällst du“ könnten wir sagen:
„Halte dich gut am Seil fest“
Iiiiii: „Iiiiiii, du stinkst“
Wenn Krippenkinder in die Windel machen, ist das Windeln wechseln nicht immer angenehm und kann unter Umständen zu einer echte Herausforderung werden. Manchmal überkommt uns dann ein Ekelgefühl und es rutscht uns so raus: „iiiiii, du stinkst!“
Wenn wir diesen Ausruf immer wieder vor dem Kind verwenden, kann es diesen als Abwertung seiner eigenen Person verstehen – insbesondere wenn wir sagen: „du stinkst“. Allerdings auch schon ein einfaches ausgerufenes „Iiiii“ hat eine abwertende Wirkung auf Kinder. Also sollten wir uns dabei beobachten, ob wir diese Ausdrücke vor den Kindern verwenden und sie unterlassen.
Dir hat der Artikel gefallen und du möchtest mir deine Wertschätzung ausdrücken? So würde ich mich über eine Spende freuen. Ich schreibe alle Artikel ehrenamtlich und bin dankbar für deine Unterstützung.