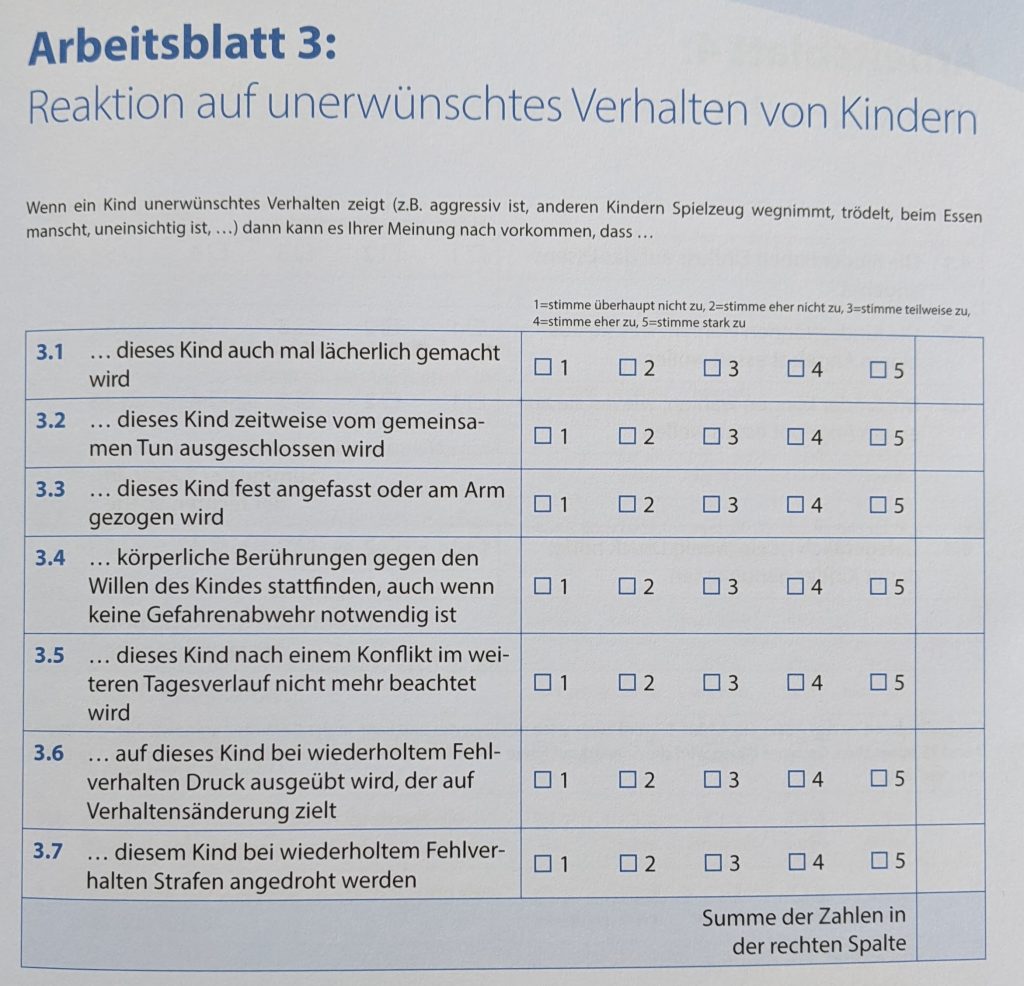Eingewöhnungen werden seit den 80er Jahren nach Modellen durchgeführt, die sich auf die beschriebenen Forschungen beziehen. Das Berliner Eingewöhnungsmodell war das erste Modell und damals eine echte Revolution. Denn bis dato wurden Kinder nicht nach bestimmten Vorgaben, sondern nur nach Bauchgefühl eingewöhnt. Es folgte das Münchener Modell, welches eine längere Eingewöhnung vorsah. Aktuell werden das Peergroup Eingewöhnungsmodell und das partizipatorische Eingewöhnungsmodell diskutiert und in Kitas implementiert. Heute ist es die Pflicht einer jeden Krippe und Kindertagesstätte, ein Eigewöhnungskonzept vorzulegen – welche Errungenschaft! Es steht schwarz auf weiß, dass kein Kind mehr einfach so unter Weinen am ersten Tag der außerfamiliären Betreuung abgegeben werden darf.
Um einen Überblick über bestehende Eingewöhnungskonzepte zu erhalten, sollen an dieser Stelle alle bekannten Eingewöhnungsmodelle in Kürze vorgestellt werden.
Es wird schwierig,
Wedewardt 2023, S. 40
wenn Eingewöhnungsmodelle
zu starr angewandt
und insbesondere,
wenn sie falsch verstanden
werden.
Das Berliner Eingewöhnungsmodell
Das Berliner Eingewöhnungsmodell (vgl. Laewen u.a., 2009) wurde in den 80er Jahren von Hans Joachim Laewen, Beate Andres und Éva Hédervári-Heller entwickelt. Ihm ist es unter anderem zu verdanken, dass bis heute jede Einrichtung ein Konzept zur Eingewöhnung vorlegen muss.
Das Modell ist gut erforscht und in seiner Struktur leicht verstehbar. Studien an der Freien Universität Berlin zeigten deutlich positive Effekte des Berliner Eingewöhnungsmodells zum Eingewöhnungsvorgehen vor dem Modell. Nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell eingewöhnte Kinder wiesen beispielsweise insgesamt ein größeres Wohlbefinden und weniger Kranksein auf .
Theoretische Grundlage
Die theoretische Grundlage des Berliner Eingewöhnungsmodells bildet die Bindungstheorie nach John Bowlby. So ist erstmals vorgesehen, dass in der Eingewöhnung eine begleitende, bekannte Bindungsperson mit in der Eingewöhnung bleibt und so als sichere Basis für das Kind zur Verfügung steht, bis das Kind eine neue Bindung zur Bezugsfachkraft aufgebaut hat. Im Berliner Eingewöhnungsmodell steht also der Beziehungsaufbau einer pädagogischen Fachkraft zu einem Kind im Fokus. Das feinfühlige Erspüren, Verstehen und Beantworten von Bedürfnissen des Kindes durch die pädagogische Fachkraft bildet das Fundament für den Beziehungsaufbau. Sobald das Kind die pädagogische Fachkraft als sichere Basis akzeptiert, kann sich die begleitende Person schrittweise zurückziehen.
Die drei klassischen Bindungsmuster „sicher“, „unsicher-ambivalent“ und „unsicher vermeidend“ können im Berliner Eingewöhnungsmodell als Hilfestellung genutzt werden, um die Eingewöhnungsdauer einzuschätzen und das fachliche Vorgehen anzupassen (vgl. Laewen u.a. 2009, S. 27ff.).
Der Ablauf
Die Dauer einer Eingewöhnung nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell soll 6 bis 14 Tage benötigen, im Einzelfall auch bis zu drei Wochen. Es wird deutlich gemacht, dass jedes Kind in seinem eigenen Tempo eingewöhnt werden und über seine Eingewöhnung mitbestimmen soll. Bindungserfahrungen, kindliche Temperamente und Vorerfahrungen des Kindes sollen in Trennungssituationen berücksichtigt werden.
Im Berliner Eingewöhnungsmodell wird ein detaillierter Ablaufplan beschrieben. Die Schritte der Eingewöhnung im Berliner Eingewöhnungsmodell sind folgende (vgl. Dreyer 2017, S 83):
1. Vorbereitungsphase: Persönliches Kennenlernen und rechtzeitig Informationen über die erwartete Beteiligung der Eltern am Eingewöhnungsprozess sowie dessen Gestaltung
2. Grundphase: 3 Tage: Die Bindungsperson bleibt mit dem Kind ca. 1 bis 2 Stunden in der Kita. Sie soll sich eher passiv verhalten und an einem Ort den “sicheren Hafen” für das Kind bilden. Es findet eine vorsichtige Kontaktaufnahme der pädagogische Fachkraft zum Kind statt, zum Beispiel in Form eines Spielangebots.
3. Erster Trennungsversuch am 3. Tag. Die erste Trennung wird am dritten Tag durchgeführt. Die gezeigte Reaktion des Kindes entscheidet folglich über die Dauer der Eingewöhnungszeit. Lässt sich das Kind nach kurzer Zeit von der PF beruhigen, kann die Trennungsdauer auf 30 Minuten ausgedehnt werden. Die Länge der Eingewöhnung soll nun ca. 6 Tage dauern. Lässt sich das Kind nach kurzer Zeit nicht oder nur schwer von der pädagogische Fachkraft beruhigen, wirkt es verstört, zeigt eine erstarrte Körperhaltung oder wirkt passiv, wird die Trennung abgebrochen und eine längere Eingewöhnung von ca. 2 bis 3 Woche eingeplant.
4. Stabilisierungsphase: Bei einer kurzen Eingewöhnung übernimmt die pädagogische Fachkraft im Beisein der Bindungsperson die Pflege-, Wickel- und Fütteraufgaben. Die Trennungsdauer wird auf ca. 1 Stunde ausgedehnt. Auch das Schlafen soll nun versucht werden. Es wird empfohlen, dass das Schlafenlegen und Aufwachen im Beisein der Bindungsperson geschieht. Ab dem 6. Tag ist der vollständige Aufenthalt des Kindes ohne Bindungsperson vorgesehen.
5 Schlussphase: Im Plan wird angegeben, dass die Bindungsperson nach der 2. Woche nicht mehr in der Einrichtung, aber jederzeit erreichbar sein soll.
Das Münchener Eingewöhnungsmodell
Das Münchener Eingewöhnungsmodell (vgl. Winner & Erndt-Doll, 2009) wurde auf der Grundlage eines Forschungsprojekt unter der Leitung von Prof. Dr. Kuno Beller, zwischen 1987 und 1991, in München entwickelt. Als theoretische Zugänge wurden hier nicht die Bindungstheorie, sondern die Transitionsforschung, die Säuglingsforschung und die Erfahrungen aus der Reggiopädagogik herangezogen.
Im Gegensatz zum Berliner Eingewöhnungsmodell, das in Anlehnung an die Bindungstheorie Kinder eher noch als hilflose Wesen sah, fußte das Münchener Eingewöhnungsmodell auf dem Bild eines kompetenten Kindes, das seine Entwicklung selbst steuern kann. Das Konzept der Transition beschreibt Kinder also als fähige Wesen, die Übergängen nicht hilflos ausgesetzt sind, sondern diese mit der Unterstützung von außen aus eigener Kraft bewältigen und aktiv mitgestalten können. Ihnen wird die Kompetenz zugesprochen, für sich selbst sorgen zu können und zu zeigen, welche Unterstützung sie bei der Bewältigung benötigen. Ziel ist es, dass das Kind gestärkt aus der Übergangserfahrung hervorgeht.
Die Transitionstheorie geht davon aus, dass Kinder ihre Erfahrungen mit Übergängen, also auch die mit der Eingewöhnung, auf folgende andere Übergänge in ihrem Leben übertragen. Gerade weil die Eingewöhnung in eine Krippe oder Kindertagespflege für die meisten Kinder der erste große Übergang in ihrem Leben darstellt, kommt diesem Übergang eine große Bedeutung zu.
Um eine positive Erfahrungen ermöglichen zu können, benötigt ein Kind, der Transitionstheorie zufolge, Unterstützung von außen. Die begleitenden Personen, Kind, Eltern, pädagogische Fachkraft aber auch der Kindergruppe spielen im Münchener Modell eine wichtige Rolle. Anders als im Berliner Eingewöhnungsmodell ist ein systemischer Blick relevant, der das soziale Netz der Eltern, deren familiäre Voraussetzungen und auch das gesamte Team der Einrichtung mit einbezieht (vgl. Griebel & Niesel, 2004). Das Wohlbefinden des einzugewöhnen Kindes wird folglich auch im Kontext der Kindergruppe gesehen. Es steht nicht ausschließlich die einzelne PF in Beziehung zum Kind im Vordergrund, sondern das gesamte Setting. Die Eingewöhnung findet also im Alltag der Betreuungseinrichtung statt und nicht separiert. Im Gegensatz zum Berliner Eingewöhnungsmodell ist ein Wechsel der Bezugspersonen während der Eingewöhnung möglich. Es wird davon ausgegangen, dass das Kind zu mehreren Personen Bindungen aufbauen kann. So erhält das Kind die Möglichkeit, seine Bezugsfachkraft selbst zu wählen.
Ziel des Münchner Eingewöhnungsmodells ist die positive Erfahrung des Kindes, einen Übergang bewältigen zu können und diese Erfahrung auf kommende Übergänge übertragen zu können.
Der Ablauf
- Vorbereitungsphase
- Kennenlernphase
- Sicherheitsphase
- Vertrauensphase
- Phase der gemeinsamen Auswertung und Reflektion
Nach allen organisatorischen und vorzubereitenden Maßnahmen und einem ersten Kennenlerngespräch in der Vorbereitungsphase, startet die Kennenlernphase, die sich im Wesentlichen vom Berliner Eingewöhnungsmodell unterscheidet. Eltern und Kind verbringen täglich 2 Stunden bis zu einem halben Tag in der Einrichtung und können selbstbestimmt alles kennenlernen. Es wird ausdrücklich betont, dass viel Zeit in der Einrichtung wichtig sei, um die Eingewöhnung voranzubringen. Nur kurze Besuche von etwa 1 Stunde würden die Eingewöhnung eher hemmen (vgl. Winner & Erndt-Doll 2009, S. 52). Eltern haben die Möglichkeit, sich frei zu bewegen und sich nicht still und unbeteiligt an einen Ort zu setzen. Der Fokus liegt eher auf dem Erfahren und Verinnerlichen von räumlichen und strukturellen Gegebenheiten als auf der individuellen Beziehungsentwicklung zu einer pädagogischen Fachkraft als Basis. Es geht darum, Sicherheit zu gewinnen über das Kennenlernen der anwesenden Personen, Räume, Strukturen und Abläufe. Während der Kennenlernphase hält sich die pädagogische Fachkraft zurück und die Hauptverantwortung liegt noch bei der begleitenden Bezugsperson. Die Kennenlernphase umfasst ca. 1 Woche.
In der Sicherheitsphase soll das Kind mit der Begleitperson bereits die Zeit in der Einrichtung bleiben, die es anschließend dort verbringen soll. Die Idee ist, dass das Kind so den gesamten strukturellen Ablauf verinnerlicht und auf diese Weise Sicherheit erfährt. Ziel ist es nun, dass sowohl das Kind als auch die Eltern so viel Sicherheit gewinnen, dass sie sich voneinander trennen können. Die begleitende Fachkraft nutzt die Beobachtungen und Erfahrungen aus der Anfangsphase, um das Kind nun passend zu begleiten – zu wissen, was ihm Sicherheit gibt, welche Interessen es hat und was ihm gut tut. Die begleitende pädagogische Fachkraft übernimmt nun mehr Betreuungsaufgaben und nähert sich dem Kind weiter an. Die Begleitperson bleibt jedoch weiterhin mit in der Einrichtung und der sichere Hafen. Die pädagogische Fachkraft versucht nach und nach eine verlässliche Beziehung zum Kind herzustellen, hegt aber nicht den Anspruch des Berliner Eingewöhnungsmodells, eine Bindung aufbauen zu müssen. Der zeitliche Rahmen für die Sicherheitsphase soll 6 Tage betragen: von Montag bis Montag. Mit dem Montag soll nach dem Wochenende keine neue Phase eingeläutet werden: So bekommt das Kind am Anfang der Woche die Chance, mit dem bereits bekannten Vorgehen erstmal wieder anzukommen.
In der Phase “Vertrauen aufbauen” liegt der Fokus darauf, dass das Kind sowohl zu den pädagogischen Fachkräften, zu den Kindern und in die Institution Vertrauen aufbaut. Ein erster Trennungsversuch sollte erst am 6. Tag erfolgen. Ein besonderes Augenmerk soll auf das Verhalten des Kindes vor und nach der Trennung gelegt werden. Kontinuierlich tauschen sich die pädagogischen Fachkräfte und Eltern über die Reaktionen und das Verhalten des Kindes aus. Empfohlen wird, die erste Trennung nicht zu lange zu machen. Die Begleitperson sollte zurückkehren, ehe das Kind ängstlich wird. Zeigt das Kind keine Trennungsängste, beträgt die Trennungszeit ca. 30 bis 60 Minuten. Je nachdem, wie gut sich das Kind beruhigen lässt, kann die Zeit in den Folgetagen ausgedehnt werden.
Zum Abschluss wird der Eingewöhnungsprozess in der Phase “Eingewöhnung auswerten” mit allen Beteiligten in einem Gespräch reflektiert. Dazu wird ein Interviewleitfaden empfohlen mit Reflexionsfragen (vgl. Winner & Erndt-Doll 2009, S.86)
Einrichtungen, die nach dem Münchener Modell eingewöhnen, nehmen sich durchschnittlich insgesamt mehr Zeit für die Eingewöhnung als Einrichtungen, die sich am Berliner Modell orientieren. Die angestrebte Dauer der Eingewöhnung nach dem Münchener Modell beträgt 12 plus 3 Tage, 12 Tage “Kennelernen” und “Sicherheit gewinnen” und 3 Tage “Vertrauen aufbauen”. Wichtiger als die Anzahl der Tage sei jedoch die Anzahl der Stunden, die das Kind in der Eingewöhnung in der Einrichtung verbringt. Kurze Besuche würden dem Münchner Modell zufolge dem Kind nicht helfen, in der Einrichtung anzukommen.
Das Tübinger Modell – Eingewöhnung in der Peergroup
Seit 2010 wird die Eingewöhnung in der Peergroup (vgl. Fink 2022; Cantzler 2022) immer bekannter. Das sogenannte Tübinger Modell nutzt die theoretischen Grundlagen der Bindungs- und Transitionsforschung sowie der Forschung über Peerbeziehungen. Die Aufmerksamkeit liegt anders als im Berliner oder Münchner Eingewöhnungsmodell auf dem Kennenlernen der Kinder untereinander.
Bei der Eingewöhnung in der Peergroup wird die Eingewöhnun nicht auf ein Kind bezogen, sondern auf eine Kindergruppe von ca. 3 bis 5 Kindern konzentriert. Auch wenn es sich um eine Gruppe von Kindern handelt, die eingewöhnt wird, hat immer das Bedürfnis des einzelnen Kindes Vorrang vor dem der Kindergruppe.
Bereits in der Vorbereitung werden mehrere Kinder mit ihren Begleitpersonen für die Eingewöhnung eingeplant. Der Beziehungsaufbau zu den Fachkräften nimmt einen wichtigen Stellenwert ein. Auf der Grundlage sich entwickelnder Beziehungen zu den pädagogischen Fachkräften, wird der Fokus jedoch darauf gelenkt, Kinder und Eltern jeweils untereinander bekannt zu machen.
Weil es sich um mehrere Kinder und ihre Familien handelt, die die Eingewöhnung besuchen, sollen auch immer mindestens zwei Fachkräfte als Tandem für die Eingewöhnung zuständig sein. Das bringt mehrere Vorteile mit sich: Erstens die Arbeitslast kann verteilt werden, zweitens die Kinder und Eltern können sich die pädagogische Fachkraft als Bezugsperson auswählen, die ihnen sympathischer ist, drittens können die beiden Fachkräften den Eingewöhnungsprozess gemeinsam reflektieren sowie das weitere Vorgehen absprechen und die Eingewöhnung muss nicht unterbrochen werden, wenn eine der beiden Fachkräften vorübergehend krank wird.
Für die Gestaltung der Peergroup-Eingewöhnung ist eine gute Planung, Zusammenarbeit und Transparenz von großer Wichtigkeit. Das Konzept der Eingewöhnung in der Peer sollte vom gesamten Team mitgetragen werden, da es gegenüber dem Berliner oder Münchener Modell vorübergehend personelle, räumliche und strukturelle Veränderungen bedeutet.
Der Vorteil des Tübinger Modell ist, dass durch die gemeinsame Eingewöhnung sowohl Kinder als auch Eltern “Gleichgesinnte” treffen, mit denen sie ihr Erleben teilen können. Das schafft Vertrauen und Wohlbefinden. Nicht nur für die Kinder ist der Übergang in die außerfamiliäre Betreuung emotional aufwühlend, sondern auch für die Begleitperson. Die Ablösung der Kinder von ihren Bezugspersonen gelänge ebenso einfacher, wenn Kinder sich in der Gegenwart von ihnen bekannten Gleichaltrigen befänden (vgl. Cantzler 2022, S. 23).
Der Ablauf
Die Eingewöhnungsgruppe startet in einem separaten Raum und lernt sich erstmal untereinander kennen. Nach ca. 1 bis 2 Wochen wird die Tür zum Alltagsgeschehen geöffnet. Ab der 3. Woche soll die Gruppe in das Alltagsgeschehen integriert werden. Der separate Raum steht den Kindern jedoch für eine Übrgngszeit jederzeit als Rückzugsort zur Verfügung.
“Die erste Eingewöhnungsphase gilt als abgeschlossen, wenn alle Kinder der Peer sich von ihren Bezugspersonen lösen konnten und zu einer oder beiden Eingewöhnungsfachkräften eine Beziehung aufgebaut haben. Endgültig ‚eingewöhnt‘ sind die Kinder erst, wenn sie mit den Räumen, dem Tagesablauf und den Ritualen der Gesamtgruppe vertraut sind und in den von Seiten der Familie ‚gebuchten‘ Betreuungszeiten – inklusive darin vorgesehener Schlüssel situationen, wie z.B. dem Mittagessen und dem Schlafen – angekommen sind.” (Fink 2022, S. 9f.). Grundsätzlich gilt: Die Kinder bestimmen ihre Trennungsschritte und werden aktiv in den Prozess einbezogen.
Die Gefahr des Peergroup-Eingewöhnungsmodell ist, dass es genutzt werden kann, um Eingewöhnungen effektiver “über die Bühne zu bringen” und dabei die tatsächlichen Bedürfnisse der Einzelnen aus dem Blick geraten. Deshalb betont Heike Fink: “Das Modell zielt in keiner Weise auf eine pragmatische, gleichzeitige und somit schnellere Eingewöhnung mehrerer Kinder ab, wie es aktuell teilweise von Trägerseite durch den verstärkten Krippenausbau oder auch pandemiebedingt favorisiert wird” (2022, S.10). Das Tübinger Modell sollte also “nicht als effizientes Kosten-Nutzen-Modell missverstanden werden” (Cantzler 2022, S. 117).
Eine Schwierigkeit
Wedewardt 2023, S. 41
von Eingewöhnungsmodellen
besteht darin,
dass eine bestimmte Ausrichtung
nicht für alle Kinder
und Eltern anwendbar ist.
Das Partizipatorische Eingewöhnungsmodell
Das Partizipatorische Eingewöhnungsmodell wurde von Prof. Dr. Marjan Alemzadeh entwickelt. Es möchte die Bedürfnisse aller Beteiligten während der Transition in den Blick nehmen. Dabei handelt sich um ein bindungsorientiertes Eingewöhnungsmodell, das die Signale von Kindern und Eltern ernst nimmt und als Grundlage für weitere Planungsschritte nutzt (vgl. Alemzadeh, 2023). Es ist Teil einer Partizipatorischen Didaktik, in der das Kind als aktiver Gestalter seiner Entwicklung und Lebenswelt gesehen wird (Schäfer & Alemzadeh, 2012). Dabei versteht sich das Partizipatorische Eingewöhnungsmodell als ein interdisziplinärer Ansatz. Es berücksichtigt aktuelle wissenschaftliche Ergebnisse aus der Pädagogik der frühen Kindheit, aus der Bindungstheorie, der Transitionsforschung, der prä-, peri- und postnatalen Psychologie sowie Erkenntnisse aus der Trauma-Pädagogik (vgl. Alemzadeh, 2023).
Ähnlich wie beim Münchner Eingewöhnungsmodell gibt es eine lange Ankommensphase. Darin lernen Begleitperson und Kind gemeinsam die Einrichtung kennen. Ein Schwerpunkt liegt in dieser Phase für die pädagogische Fachkraft auf der wahrnehmenden Beobachtung, die ermöglicht, dass das Kind und seine Begleitperson mit ihren Signalen wahrgenommen werden können. Auf der Grundlage der Beobachtungen kann die pädagogische Fachkraft passend und responsiv auf diese Signale eingehen und die Erkenntnisse im weiteren Eingewöhnungsprozess situationsadäquat einsetzen. Die individuellen Bedürfnisse der Kinder sind der Ausgangspunkt für das pädagogische Handeln im Eingewöhnungsprozess. Sowohl Kinder als auch Eltern werden partizipativ in den Prozess ihrer Eingewöhnung eingebunden. Damit die Eingewöhnung so natürlich wie möglich stattfindet, nimmt die Begleitperson eine aktive Rolle ein, ähnlich wie bei einer ersten Trennungserfahrung im familiären Umfeld. Es gibt keinen festen Zeitplan, vielmehr wird darauf geachtet, ob Begleitperson und Kind Merkmale zeigen, die darauf schließen lassen, dass die beiden bereit für eine erste Trennung sind. In den ersten zwei Wochen wird keine Trennung empfohlen, da das Kind und seine Begleitperson meist gute 14 Tage für den Beziehungsaufbau zu der pädagogischen Bezugsfachkraft benötigen.
Der Ablauf (vgl. Alemzadeh 2021a, S. 39)
- Phase: Informieren
Die Eingewöhnung wird vorbereitet: erste Gespräche zwischen Eltern und der Leitung; Eltern können hospitieren. In einem ausführlichen Anamnese-Gespräch werden Erfahrungen mit Geburt und Trennung erfragt.
- Phase: Ankommen in der Einrichtung
Kind und Eltern bekommen Zeit, um sich mit dem Ort vertraut zu machen; gegenseitiges Vertrauen wird gefördert. Die Eltern dürfen sich in der Einrichtung frei bewegen und am gesamten Kita-Alltag teilhaben.
- Phase: In Kontakt gehen
Die pädagogische Fachkraft nutzt ihre Beobachtungen für passgenaue Spielangebote, so dass das Kind sich mit seinen Bedürfnissen wahrgenommen und gesehen fühlt.
- Phase: Beziehungen aufbauen
Wenn die pädagogische Fachkraft spürt, dass das Kind gerne mit ihr in Kontakt geht und auf die Spielangebote eingeht, ohne sich dabei immer bei den Eltern abzusichern, beginnt der Beziehungsaufbau. Die pädagogische Fachkraft übernimmt nun auch nach und nach Pflegetätigkeiten, wie dem Kind etwas zu essen oder trinken anzubieten, mit dem Kind Hände waschen zu gehen oder es auch mal auf den Arm zu nehmen, wenn das Kind dies möchte.
- Phase: Sich in der Einrichtung wohlfühlen
Wenn das Kind morgens freudig ankommt, auf die Begrüßung eingeht, sich an Interaktionen beteiligt und eigenständig die Umwelt erkundet, signalisiert es: „Ich bin angekommen.“ Das Kind zeigt, dass es die Kita-Strukturen gut verinnerlicht hat, weiß was als nächstes folgt und es zeigt vor allem, dass es sich in der Nähe seiner Bezugserzieherin sicher fühlt und Freude an der Erkundung der neuen Umgebung zeigt.
- Phase: Bereit für den Abschied
Eltern und Kind entscheiden über den Zeitpunkt der ersten Trennung aktiv mit. Die pädagogische Fachkraft sucht das Gespräch mit dem Elternteil vor der ersten Trennung. Sie reflektieren gemeinsam darüber, welche Merkmale das Kind schon zeigt, dass es gut angekommen ist. Auch das Elternteil sollte Vertrauen gefasst und sich in der Einrichtung wohlfühlen. Sie wird explizit gefragt, ob sie bereit für eine erste Trennung ist oder noch nicht. Auch das Kind gibt gewissermaßen sein Einverständnis, da erst dann über eine Trennung nachgedacht wird, wenn das Kind über verschiedene Merkmale zeigt, dass es gut in der Kita angekommen ist und eine sichere Beziehung zu seiner Bezugsfachkraft aufgebaut hat.
Phase: Die Einrichtung wird zum Alltag
Gelingt die Trennung von den Eltern ohne Proteste, beteiligen sich die Kinder aktiv an Alltags- und Spielsituationen und zeigen dabei, dass es ihnen gut geht, so wird die Zeit ohne Eltern Stück für Stück ausgebaut.
In der Partizipatorischen Eingewöhnung bekommen die Prägungen und (unbewussten) Erfahrungen der Beteiligten erstmals eine besondere Aufmerksamkeit (vgl. Alemzadeh, 2021b). Sie werden als Einflussfaktor für eine gelingende Eingewöhnung mitgedacht. Auch das Traumapotenzial einer wenig sensiblen Eingewöhnung wird thematisiert und in den Fokus gerückt.
Oberstes Ziel der Partizipatorischen Eingewöhnung ist es somit, dass die Eingewöhnung vom Kind und Elternteil aktiv mitgestaltet werden kann und sie bei diesem Prozess feinfühlig und professionell begleitet werden. Die Eingewöhnung soll so gestaltet werden, dass das psychische, seelische, geistige und körperliche Wohlbefinden des Kindes gewahrt werden kann.
Jedes Kind braucht
Wedewardt 2023, S. 42
seine individuelle
Zeit und seinen individuellen
Rahmen.
Die kultursensible Eingewöhnung
In einer Gesellschaft, die von vielen verschiedenen Kulturen geprägt ist, wie die heutige, ist es unerlässlich, dass auch die Eingewöhnung an den verschiedenen Kulturen, deren Werten und Bedürfnissen ausgerichtet wird. Deshalb nehmen sich immer mehr Kitas und Krippen vor, auch die Eingewöhnung an den verschiedenen Kulturen auszurichten.
Bei der “herkömmlichen” Eingwöhnungsgestaltung zum Beispiel nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell wird von einer westlichen Sicht auf Beziehungen ausgegangen, in der eine Bezugsperson eine intensive Beziehung zu einem Kind durch ein feinfühliges Handeln aufbaut. “Im Kulturvergleich zeigt sich jedoch, dass Bindungsbeziehungen ganz unterschiedlich gestaltet und bewertet werden. Der Fokus auf die Mutter bzw. eine Hauptbezugsperson wird bspw. außerhalb der westlichen Mittelschicht nicht unbedingt geteilt bzw. mitunter auch explizit abgelehnt” (Lamm 2018, S. 1). So kann es sein, dass Kinder, die in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, in der regelmäßige Wechsel der Bezugspersonen normal waren, sie den Eintritt in den Kindergarten oder die Krippe als nicht so herausfordernd wahrnehmen.
In einer kultursensiblen Eingewöhnung werden also die unterschiedlichen kulturellen Prägungen von Familien und ihren Kindern berücksichtigt, ohne ein bestimmtes Eingewöhnungs-Verfahren, das an die westliche Kultur angepasst ist, wie beispielsweise das Berliner Eingewöhnungsmodell, “überzustülpen”. Kulturgeprägte, individuelle Erwartungen der BP und die für das Kind bekannten, kulturbedingten Betreuungsvorerfahrungen werden in der kultursensiblen Eingewöhnung thematisiert und im Ankommensprozess berücksichtigt.
Die Bedürfnisorientierte Beziehungszeit (Eingewöhnung)
Die theoretischen Grundlagen für das bedürfnisorientierte Ankommen in der Einrichtung bildet die bedürfnisorientierte Pädagogik (vgl. Wedewardt & Hohmann 2021). Als theoretisches Fundament ist neben der Bindungsforschung, der Transitionsforschung, der Psychotraumatologie, der Achtsamkeitsforschung und der Neurowissenschaft auch die Gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg (2016) hervorzuheben.
Die bedürfnisorientierte Beziehungszeit (vgl. Wedewardt 2023) ist von einem individuellen Vorgehen geprägt, das sich an den beteiligten Menschen ausrichtet. Es bezieht die individuellen Temperamente, die unterschiedlichen neuronal-genetischen Voraussetzungen (Neurodivergenzen), kulturellen Hintergründe, Eigenheiten und Interessen jedes Beteiligten mit ein. Auf diese Weise ist jede bedürfnisorientierte Eingewöhnung einzigartig.
Die bedürfnisorientierte Beziehungszeit macht sich frei von Eingewöhnungsmodellen, die einen bestimmten Ablauf oder einen Zeitrahmen vorgeben. Es wird davon ausgegangen, dass jeder Mensch so unterschiedliche Voraussetzungen mitbringt, dass Modelle dem Einzelnen im Ankommensprozess kaum gerecht werden können. Es gibt Voraussetzungen, die dazu führen können, dass der Ankommensprozess schnell verläuft, es ist aber auch möglich, dass die erste Trennung nach vier Wochen stattfindet. Alles darf sein – immer an den Gefühlen und Bedürfnissen der Beteiligten ausgerichtet. Jeder bekommt das, was er braucht.
Entsprechend des Menschenbildes der Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg (2016) wird auch im Ankommensprozess davon ausgegangen, dass jeder Mensch zu jeder Zeit sein bestmögliches Verhalten zeigt, um sich seine Bedürfnisse zu erfüllen. Egal, wie Menschen sind, was sie tun, was sie sagen oder wie sie sich verhalten, sie streben danach,
sich ihre Bedürfnisse zu erfüllen, um psychisch und physisch gesund zu bleiben.
Bedürfnisorientiert in einer außerfamiliären Einrichtung anzukommen bedeutet, dass die Bedürfnisse aller Beteiligten – die des Kindes, der Begleitperson und der pädagogischen Fachkraft – wahrgenommen und berücksichtigt werden. Ebenso wird den Gefühlen aller Raum geschenkt und ihre Grenzen gewahrt. Die Beteiligten dürfen den Prozess des Ankommens mitgestalten.
Literatur
Alemzadeh, M. (2023): Partizipatorische Eingewöhnung. Freiburg im Breisgau: Herder.
Alemzadeh, M. (2021a): Traumafrei eingewöhnen. In: TPS Theorie und Praxis der Sozialpädagogik, Traumapädagogik. Heft 9/21. S. 36–39.
Alemzadeh, M. (2021b): Die Tränen der Vergangenheit. In: TPS – Theorie und Praxis der Sozialpädagogik, Traumapädagogik. Heft 9/21. S. 40–43.
Cantzer, A. (2022): Peergroup-Eingewöhnung. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
Dreyer, R. (2017): Eingewöhnung und Beziehungsaufbau in Krippe und Kita. Freiburg im Breisgau: Herder.
Fink, H (2022): Die Eingewöhnung in der Peer – das Tübinger Modell. In: Kita Fachtexte. Online abrufbar unter: https://www.kita-fachtexte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/220327_KitaFachtexte_Fink_02.pdf (Letzter Zugriff am 28.03.2023).
Griebel, W. & Niesel, R. (2016): Übergänge verstehen und begleiten. Transitionen in der Bildungslaufbahn von Kindern. Berlin: Cornelsen.
Griebel, W. & Niesel, R. (2004): Transitionen. Fähigkeiten von Kindern in Tageseinrichtungen fördern, Veränderungen erfolgreich zu bewältigen. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
Laewen, H-J.; Andres, B. & Hédervári, É. (2007): Die ersten Tage – ein Modell zur Eingewöhnung in Krippe und Tagespflege. Cornelsen.
Lamm, B. (2018): Wie gestaltet sich Kita-Eingewöhnung aus interkultureller Perspektive? In: Kita-Einstieg – Wissen kompakt https://kita-einstieg.fruehe-chancen.de/fileadmin/PDF/Kita-Einstieg/nifbe-Kita-Einstieg-Wissen-kompakt_Eingewoehnung_interkulturell.pdf (Letzter Zugriff am 28.01.2023).
Schäfer, G. E. & Alemzadeh, M. (2012). Wahrnehmendes Beobachten. Beobachtung und Dokumentation am Beispiel der Lernwerkstatt Natur. Weimar: verlag das netz.
Wedewardt, L. (2023): Ankommen dürfen statt loslassen müssen. Freiburg im Breisgau: herder.
Winner, A. & Erndt-Doll, E. (2009): Anfang gut? Alles besser! Ein Modell für die Eingewöhnung in Kinderkrippen und anderen Tageseinrichtungen für Kinder. Berlin: Verlag das Netz.